Nach der Reha
+ Kapitelübersicht anzeigen
Wohnen zu Hause
Ihr Kind kann nach der Entlassung aus der Rehabilitationsklinik unter bestimmten Umständen wieder zu Hause wohnen. Je nach Pflegebedarf und Ihrer individuellen Situation gibt es verschiedene Vorbereitungen zu treffen.
Pflege möglich machen
Um die Pflege zu Hause zu ermöglichen oder zu erleichtern, sind bestimmte Voraussetzungen hilfreich. Hierzu zählen Anpassungen des Wohnraums, Hilfsmittel und Mobilität.
Anpassungen des Wohnraums
Bei der Versorgung zu Hause werden in der Regel Anpassungen des Wohnraums erforderlich. Wie schnell und umfangreich solche Anpassungen vorgenommen werden müssen, hängt von baulichen Gegebenheiten, Alter, Größe und Gewicht Ihres Kindes ab. Bei kleinen Kindern, die noch getragen werden, ist beispielsweise eine Treppe im Haus kein unüberwindliches Hindernis; bei größeren Kindern stellt sich das schon anders dar. Sobald ein Rollstuhl oder Rehabuggy für die Mobilität wichtig ist, werden bauliche Merkmale wie die Breite von Türen oder die Höhe von Türschwellen ausschlaggebend.
Worauf beim Umbau genau zu achten ist und welche Umbaumaßnahmen sinnvoll sein können, dazu finden Sie wichtige Hinweise unter diesen Links:
Folgende Fragen können helfen, sich einen Überblick zu verschaffen:
- Ist die Haus- und/oder Wohnungstür barrierefrei erreichbar?
- Ist das Badezimmer mit einem Rollstuhl/Rehabuggy befahrbar beziehungsweise ist die Benutzung des Badezimmers notwendig?
- Ist das Kinderzimmer erreichbar? Kann es umgelegt werden in ein leichter erreichbares Zimmer?
- Sind die Türen in der Wohnung breit genug und gibt es genügend Platz zum Rangieren?
- Gibt es Schwellen, die abgeflacht werden können/sollen?
- Ist im Kinderzimmer ausreichend Platz für ein Pflegebett und benötigte Hilfsmittel?
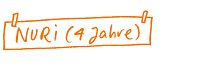
Bei Nuris Mutter konnten die Türen vorerst noch im Standardmaß belassen werden, weil der Rehabuggy wendig und nicht viel größer als ein normaler Buggy ist. Der Zugang zur Wohnung wurde jedoch barrierefrei umgebaut, und zum Baden hat Nuri eine Wannenliege. Wenn Nuri größer wird, stehen weitere Umbauten an.
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
(nach § 40 Absatz 4 SGB 11)
Die Pflegeversicherung unterstützt Umbaumaßnahmen in Haus oder Wohnung unter bestimmten Umständen – etwa, wenn die Umbaumaßnahmen der Vermeidung einer Heimunterbringung Ihres Kindes und der Erleichterung der Pflege dienen. Dann werden Kosten in Höhe bis zu 4.180 Euro je Maßnahme übernommen.
Beispiele für solche bezuschussbaren „wohnumfeldverbessernden Maßnahmen“ sind: Einbau einer bodengleichen Dusche, Einbau und Anbringung von Treppenliften oder Türverbreiterungen. Aber auch Kosten für statische Gutachten, Antragsgebühren, Fahrtkosten und Verdienstausfall von am Bau mithelfenden Angehörigen und Bekannten können im Rahmen der wohnumfeldverbessernden Maßnahmen berücksichtigt werden.
Gut zu wissen:
Als eine Maßnahme gilt die Summe aller notwendigen und anerkannten Umbauten zum Zeitpunkt der Zuschussgewährung. Eine erneute Maßnahme kann erst bei erheblicher Verschlechterung bzw. Veränderung der Pflegesituation bezuschusst werden.
Wichtiges zur Antragstellung
Wichtig ist, dass der Antrag vor Baubeginn
gestellt wird und dass Sie mit den Umbauten erst beginnen, wenn Ihnen eine Kostenbeteiligung zugesagt wurde. Andernfalls wird keine finanzielle Unterstützung gewährt.
In Einzelfällen werden die Kosten auch übernommen, wenn die Antragstellung nach Baubeginn oder -abschluss erfolgt und die Anspruchsvoraussetzungen vor Baubeginn erfüllt waren. Ratsamer ist es jedoch, den Antrag VOR Baubeginn zu stellen und mit den Umbauten erst zu beginnen, wenn Ihnen eine Kostenbeteiligung zugesagt wurde.
Die Höhe der Kostenbeteiligung liegt in der Entscheidung der Pflegeversicherung. Möglicherweise beauftragt diese den MD, die häusliche Situation zuvor in Augenschein zu nehmen.
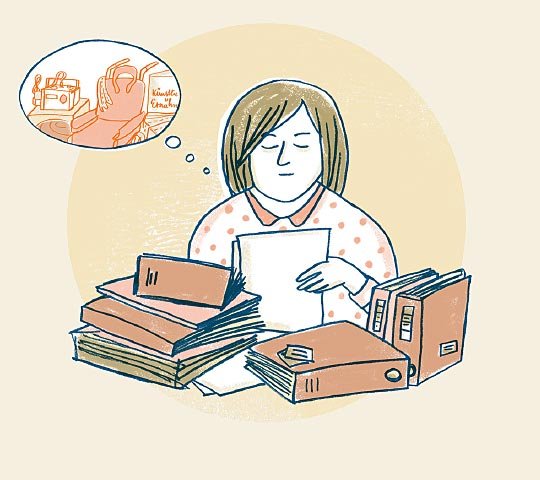
Reicht der Zuschuss der Pflegeversicherung für die notwendigen Umbaumaßnahmen nicht aus, können auch Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beantragt werden.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 113 Absatz 2 Nummer 1 SGB 9 in Verbindung mit § 77 Absatz 1 SGB 9
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Träger der Eingliederungshilfe. Welche Behörde für die Leistungen der Eingliederungshilfe zuständig ist, ist je nach Bundesland unterschiedlich. Auf örtlicher Ebene können das zum Beispiel Kreise und kreisfreie Städte oder auf überörtlicher Ebene Wohlfahrtsverbände, Landschaftsverbände und Landesämter sein.
Darüber hinaus bieten Länder und Kommunen zum Teil besondere finanzielle Hilfen für den barrierefreien Bau oder Umbau von Wohnungen und Häusern an. Das örtliche Wohnungsamt oder Wohnberatungsstellen können hierzu Auskünfte erteilen. Eine Liste mit Wohnberatungsstellen sortiert nach Bundesländern finden Sie auf der Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V.:
www.wohnungsanpassung-bag.de
Zudem fördert die KfW-Bankengruppe den barrierefreien Umbau und Kauf von barrierefreien Wohnungen und Häusern. Sie können dort einen Zuschuss sowie einen Kredit mit einem geringen Zinssatz erhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite der KfW Bank: www.kfw.de
Hilfsmittel
Während des Aufenthalts in der Rehabilitationsklinik hat Ihr Kind sicher schon einige Hilfsmittel erhalten; zum Beispiel einen Rehabuggy oder einen Rollstuhl. Bei der Entlassung in das häusliche Umfeld werden dann noch weitere Hilfsmittel benötigt, beispielsweise ein Pflegebett, ein Therapiestuhl, Lagerungskissen oder ein Lifter. Welche Hilfsmittel das im Einzelnen sind, ist von Fall zu Fall verschieden. Der Sozialdienst in der Reha unterstützt Sie bei der Beantragung der Hilfsmittel, die Ihr Kind braucht.
Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Pflegehilfsmitteln (die von der Pflegekasse gezahlt werden) und Hilfsmitteln (die von der Krankenkasse gezahlt werden).
Pflegehilfsmittel sind zum Beispiel Produkte zur Ermöglichung und Erleichterung der Pflege (ein Pflegebett, Waschsysteme …) sowie Produkte zur Linderung von Beschwerden (wie Lagerungskissen). Ein Antrag auf Kostenübernahme für Pflegehilfsmittel kann ohne ärztliche Verordnung bei der Pflegekasse gestellt werden, muss aber eine überzeugende Begründung dafür enthalten, warum das Pflegehilfsmittel benötigt wird. Stellungnahmen von Pflegekräften oder Therapeutinnen und Therapeuten sind dabei oft hilfreich.
Anders ist das bei den von der Krankenkasse finanzierten Hilfsmitteln, die dazu dienen, einer Behinderung vorzubeugen oder sie auszugleichen (zum Beispiel Absauggeräte, Therapiestühle, Autositze). Diese Art von Hilfsmitteln kann nur ärztlich verordnet werden.
Auf der Website des GKV-Spitzenverbandes unter www.gkv-spitzenverband.de findet sich ein fortlaufend aktualisiertes Hilfsmittelverzeichnis mit allen Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, für die die Kosten bei Notwendigkeit übernommen werden.

Achtung:
Nur weil ein Hilfsmittel hier gelistet ist, heißt es nicht automatisch, dass Ihr Antrag darauf auch immer direkt genehmigt wird. Rechnen Sie mit Ablehnungen und der Notwendigkeit eines Widerspruchs. Gut zu wissen ist außerdem: Im Einzelfall können durchaus auch schon einmal Hilfsmittel, die nicht im Verzeichnis gelistet sind, genehmigt werden.
Die Genehmigung Ihres Antrags erfolgt in der Regel, indem Sie von der Pflege- oder Krankenkasse eine Bestätigung über die Notwendigkeit und eine Kostenzusage erhalten. Diese legen Sie beim jeweiligen Anbieter des Hilfsmittels (zum Beispiel Sanitätshaus oder Apotheke) vor. Der Anbieter rechnet dann direkt mit der Kranken- beziehungsweise Pflegekasse ab.
Pflegebedürftige, die zu Hause oder in einer Wohngemeinschaft gepflegt werden, haben außerdem Anspruch auf sogenannte „zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel“ in Höhe von 42 Euro monatlich. Hierzu zählen beispielsweise Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Mundschutze.
Eine vollständige Auflistung findet sich im Pflegehilfsmittelverzeichnis des GKV Spitzenverbandes unter der Produktgruppe 54.
Inkontinenzprodukte wie Windeln sind wiederum Hilfsmittel der Krankenversicherung und fallen nicht unter die zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel. Sie können stattdessen von der Ärztin oder vom Arzt verordnet werden.
Mobilität
Mit einem Kind mit einer komplexen Behinderung verändern sich auch die Möglichkeiten der Mobilität. Häufig wird ein spezieller Autositz für das Kind benötigt, der als Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragt werden kann. Wenn kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung steht und die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht infrage kommt, können Ärztinnen und Ärzte sogenannte Krankenfahrten oder Krankentransporte verordnen.
Manchmal ist auch ein Umbau oder gar die Anschaffung eines neuen, behinderungsgerechten Autos unumgänglich. Wenn Sie aus eigenen Mitteln die Anschaffung eines geeigneten und/oder speziell umgebauten Autos nicht leisten können, können Sie unter Umständen einen staatlichen Zuschuss und Spenden von fördernden Organisationen erhalten. Was dafür notwendig ist und wie man am besten vorgeht, lesen Sie in unserer umfangreichen Lumia-Informationsschrift „Wir brauchen ein Auto“. Diese können Sie bei Interesse kostenfrei bei uns bestellen.
Unterstützung finden
Ein wohnortnahes Netz aus Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten und gegebenenfalls einem Pflegedienst unterstützt Sie bei der weiteren Versorgung Ihres Kindes.
Ärztliche Versorgung
Zu Hause erfolgt die ärztliche Versorgung in der Regel über Haus- beziehungsweise Kinderärztinnen und -ärzte sowie weitere Fachärztinnen und -ärzte, etwa aus der Neurologie oder Orthopädie. Diese stellen Ihnen dann auch die Verordnungen für Therapien, Medikamente sowie Hilfsmittel aus, die Ihr Kind benötigt.
Wichtig:
Es ist nicht davon auszugehen, dass alle (Kinder-)Ärztinnen und Ärzte Erfahrungen im Umgang mit dem Krankheitsbild der schweren erworbenen Hirnschädigung haben. Wir empfehlen Ihnen daher, schon vor der Entlassung aus der Rehaklinik mit der vertrauten ärztlichen Praxis Kontakt aufzunehmen und zu erfragen, ob sie die weitere Betreuung übernehmen kann.
Therapien
Das ärztliche Personal in der Rehabilitationsklinik spricht in der Regel bereits Empfehlungen über die Häufigkeit von Therapien aus, die die haus- beziehungsweise kinderärztliche Praxis in Zukunft verordnen soll (zum Beispiel Logopädie, Physio- und Ergotherapie). Die Häufigkeit der Therapien nimmt im Vergleich zur Rehaklinik deutlich ab. Therapieformen wie die Musiktherapie oder die tiergestützte Therapie, die in manchen Kliniken zum Alltag gehören, werden von den Krankenkassen ambulant meist nicht mehr finanziert.
Es ist nicht immer leicht, geeignete Therapeutinnen und Therapeuten zu finden, die sowohl Erfahrungen in der therapeutischen Arbeit mit Menschen mit schweren Hirnschädigungen als auch im Umgang mit Kindern haben. Das bezieht sich auch auf die Suche nach bestimmten Therapieverfahren, die Eltern aus der Reha kennen (zum Beispiel Bobath, Vojta, Affolter, Castillo Morales) und häufig gerne ambulant fortsetzen lassen würden.
Eine wichtige Überlegung bei der Auswahl ist, ob die Therapeutinnen und Therapeuten Hausbesuche anbieten können. Manchmal kann die therapeutische Versorgung auch im Kindergarten, in der Schule oder in der Tagesförderstätte erfolgen.
Um Eltern, Kinder, aber auch die Budgets der ärztlichen Praxen zu entlasten, besteht bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung einen Bedarf an Therapien von mindestens einem Jahr haben, ein sogenannter langfristiger Heilmittelbedarf. Diese Verordnung erfolgt außerhalb der Regel und bedarf bei entsprechender Diagnose keiner Genehmigung durch die Krankenkasse.
Unser Tipp:
Wenn Sie Therapiemethoden kennenlernen, für die die Krankenkasse keine Kosten übernimmt, können Sie probieren, eine solche Therapie durch Spenden zu finanzieren – diese können aus Ihrem privaten Umfeld oder von fördernden Stiftungen stammen. Sprechen Sie uns darauf gerne an.
Sozialpädiatrische Zentren
Ein Sozialpädiatrisches Zentrum – kurz SPZ genannt – ist oft ein wichtiger Baustein in der ambulanten Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ganz verschiedenen Erkrankungen, Beeinträchtigungen und Behinderungen. Die besondere Kompetenz dieser Zentren liegt vor allem in der engen Zusammenarbeit von verschiedenen Fachbereichen wie Kinder- und Jugendmedizin, Psychologie, Ergo- und Physiotherapie und Logopädie. Die Behandlungen können dementsprechend medizinische, psychologische, therapeutische und pädagogische Hilfen und Beratungen umfassen. In der Regel wird ein individueller Behandlungs- und Förderplan aufgestellt. Darüber hinaus gibt es oft noch weitere Angebote, die sich allerdings von SPZ zu SPZ auch unterscheiden können. Nicht selten wird zum Beispiel eine Hilfsmittelsprechstunde angeboten. Für die Anbindung an ein SPZ benötigen Sie eine Überweisung der kinderärztlichen Praxis. Sprechen Sie die Ärztin/den Arzt Ihres Kindes auf diese Möglichkeit an.
Ein vergleichbares Angebot für Erwachsene bieten die sogenannten Medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung – kurz MZEB.
Unterstützung bei der Pflege
Wenn Sie bei der Pflege Ihres Kindes zu Hause Unterstützung benötigen, können Sie die Hilfe eines Pflegedienstes nutzen. Dabei sind 2 verschiedene Leistungsarten zu unterscheiden: Die Pflegesachleistung, die pflegerische Hilfe umfasst, und die medizinische Behandlungspflege. Näheres zu diesem Unterschied finden Sie im nächsten Kapitel.
Bei der Auswahl eines geeigneten Pflegedienstes empfiehlt es sich, nach Möglichkeit einen spezialisierten (Intensiv-) Kinderkrankenpflegedienst zu beauftragen. Leider sind diese gerade in ländlichen Regionen nur vereinzelt vertreten. Auch der deutschlandweite Fachkräftemangel macht es ratsam, schon frühzeitig mit der Suche zu beginnen. Bevor ein Vertrag abgeschlossen wird, kommt es zu einem persönlichen Kennenlernen. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Pflegedienstes besuchen die Familie dann möglicherweise noch in der Rehaklinik.

Altersentsprechende Förderung
Auch für Kinder mit komplexen Erkrankungen gilt das Recht auf Bildung, die Schulpflicht sowie das Recht auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Je nach Alter ergeben sich dabei folgende Möglichkeiten:
- Frühförderung
Bis zum Kindergarteneintritt können pädagogische und therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Frühförderung erfolgen. Angeboten wird diese in der Regel von speziellen Frühförderstellen. - Kindergarten
Kinder mit komplexen Behinderungen besuchen oft einen heilpädagogischen oder einen integrativ arbeitenden Kindergarten. - Schule
Die Beschulung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: inklusiv an einer Regelschule, an einer speziellen Förderschule oder in Ausnahmefällen auch zu Hause. Dem besonderen Bedarf von Kindern mit schweren erworbenen Hirnschädigungen kann häufig am besten an Förderschulen mit den Schwerpunkten geistige oder motorische und körperliche Entwicklung entsprochen werden. - Tagesförderstätte
Ist die Schulzeit erfüllt, kommt der Besuch einer Tagesförderstätte infrage. Menschen mit komplexen Behinderungen, die keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen können, haben hier die Möglichkeit, eine Tagesstruktur mit Betreuung und Förderung zu erfahren.
Bei allen Einrichtungen empfiehlt es sich, direkten Kontakt aufzunehmen, ein unverbindliches Gespräch zu führen und eine Besichtigung zu vereinbaren.
Unser Tipp:
Ist die Betreuung im Kindergarten oder in der Schule nicht allein durch das Personal sicherzustellen, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Assistenz oder eine extra Schulbegleitung für Ihr Kind genehmigt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Begleitung des Schulbesuchs durch den Pflegedienst.
Finanzierung der Pflege
Sobald ein Pflegegrad vorliegt, kann die Pflege Ihres Kindes über verschiedene Leistungen der Pflegeversicherung finanziert werden. Sie können Pflegegeld, Pflegesachleistung oder die sogenannte Kombinationsleistung erhalten.
| Pflegegrad | Pflegegeld | Pflegesachleistung |
|---|---|---|
| 2 | 347Euro | 796 Euro |
| 3 | 599 Euro | 1.497 Euro |
| 4 | 800 Euro | 1.859 Euro |
| 5 | 990 Euro | 2.299 Euro |
Pflegegeld
Wenn Sie die Pflege Ihres Kindes zu Hause übernehmen, erhalten sie Pflegegeld. Je nach Pflegegrad variiert die monatliche Höhe des Pflegegeldes. Anspruchsberechtigt ist man erst ab Pflegegrad 2.
Pflegesachleistung
Wenn Sie die Pflegesachleistung wählen, kann ein Pflegedienst die Pflege Ihres Kindes übernehmen, bis der Pflegesachleistungsbetrag ausgeschöpft ist. Der Pflegedienst kommt täglich (gegebenenfalls mehrmals) zu Ihnen und übernimmt zum Beispiel das Waschen Ihres Kindes oder die Nahrungsgabe. Die Pflegesachleistung ist höher als das Pflegegeld, weil Fachkräfte teurer sind als „Laien“.
Achtung:
Der Sachleistungsbetrag reicht allerdings nicht aus, um alle anfallenden Pflegeaufgaben vom Pflegedienst übernehmen zu lassen.
Kombinationsleistung
Wenn Sie die Pflege in Teilen selbst übernehmen wollen und in Teilen einen Pflegedienst hinzuziehen möchten, können Sie die Kombinationsleistung in Anspruch nehmen. Sie erhalten dann anteilig Pflegegeld und der Pflegedienst erhält anteilig die Pflegesachleistung. Diese rechnet der Pflegedienst direkt mit der Pflegeversicherung ab.

Die Familie von Charlotte erhält 990 Euro Pflegegeld bei Pflegegrad 5, weil sie für die pflegerische Versorgung keine Unterstützung hinzuzieht. Ein Anspruch auf medizinische Behandlungspflege kann trotzdem bestehen.
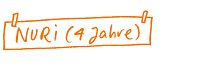
Nuris Mutter erhält, weil sie es im Rahmen der Kombinationsleistung vereinbart hat, 50 Prozent des Pflegegeldes für Pflegegrad 4 (400 Euro), ihr Pflegedienst erhält 50 Prozent der entsprechenden Pflegesachleistung (929,50 Euro). Wenn der Pflegedienst wegen Personalknappheit nicht alle Dienste abdecken kann, erhält Nuris Mutter einen entsprechend höheren Anteil des Pflegegeldes, weil die Abrechnung monatlich erfolgt.
Entlastung im Pflegealltag
Die 3 gängigsten Möglichkeiten von Entlastungsleistungen stellen wir Ihnen in den folgenden Beispielen vor. Ausführliche Informationen zu den Leistungen und zur Beantragung finden Sie in „Langzeitentlastung“ .
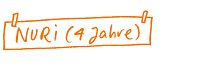
Entlastungsbetrag (§ 45b SGB 11)
131 Euro monatlich
Nuri verbringt jede Woche einen Nachmittag mit einer Mitarbeiterin vom familienentlastenden Dienst. Gemeinsam mit ihr macht sie Spaziergänge oder kleine Unternehmungen. Manchmal gehen die beiden auch mit Nuris Mutter schwimmen. Die Finanzierung erfolgt über den Entlastungsbetrag.

Kurzzeitpflege (§ 42 SGB 11)
3.539 Euro jährlich zusammen mit der Verhinderungspflege
Charlottes Eltern machen jedes Jahr einen Urlaub allein mit Charlottes Bruder. Diese Zeit verbringt Charlotte in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung. Für die Finanzierung setzen ihre Eltern ihr Kurzzeitpflegebudget ein:
Der Tagessatz dieser Einrichtung beträgt rund 175 Euro für Kurzzeitpflege. Der gemeinsame Jahresbetrag für Kurzzeit- und Verhinderungspflege in Höhe von 3.539 Euro wird hier komplett für die Kurzzeitpflege eingesetzt und reicht somit für 20 Tage Pflege. Für die Verhinderungspflege bleiben in diesem Fall keine Mittel mer übrig.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die in der Einrichtung zusätzlich anfallen, finanzieren Charlottes Eltern aus dem Entlastungsbetrag, sofern sie ihn noch nicht anderweitig verbraucht haben.
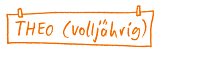
Verhinderungspflege (§ 39 SGB 11)
3.539 Euro jährlich zusammen mit der Kurzzeitpflege
In der Region, in der Theo lebt, gibt es Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen an den Wochenenden. Als er noch zu Hause wohnte, nahm er mehrmals im Jahr daran teil. Die Finanzierung erfolgte über die Verhinderungspflege.
Achtung:
Kurzzeit- und Verhinderungspflege greifen ab 2025 auf einen Gemeinsamen Jahresbetrag in Höhe von 3.539 Euro zu. Ausführliche Informationen zu den Leistungen finden Sie in unserem Heft "Langzeitentlastung ".